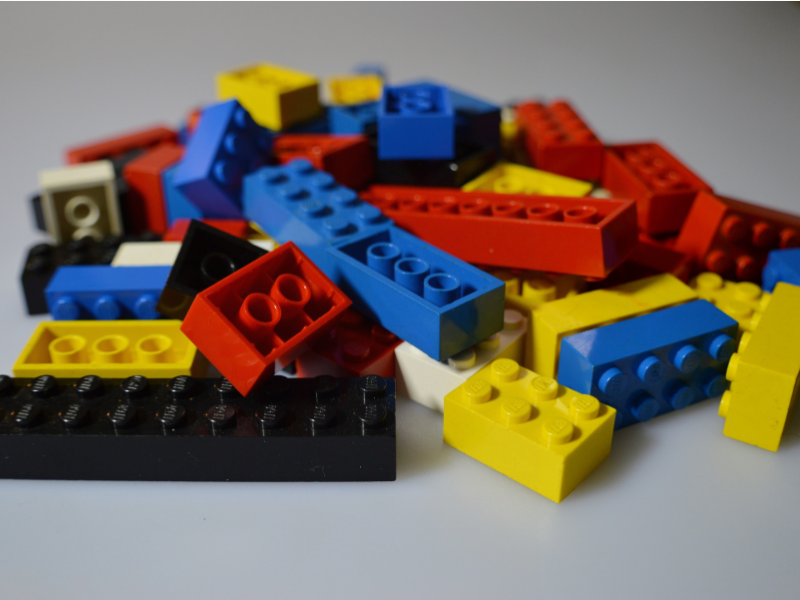„Sei doch nicht so egoistisch!“ – Was dieser Satz mit Kindern macht
November 3, 2025
Vor kurzem erzählte mir eine Freundin eineSzene aus dem Flugzeug:
Ein Vater wandte sich an seinen Sohn und sagte: „Sei doch nicht so egoistisch.“
Ein kurzer Satz, beiläufig ausgesprochen – und doch trägt er eine Menge psychologisches Gewicht.
Was Egoismus eigentlich ist
Im Kern bedeutet Egoismus, die eigenen Bedürfnisse, Wünsche und Interessen in den Vordergrund zu stellen – manchmal ohne Rücksicht auf andere.
Das Wort ist in unserer Gesellschaft stark negativ belegt, dabei hat es auch eine gesunde Seite:
- Selbstschutz: Sicherstellen, dass man selbst nicht zu kurz kommt.
- Grenzsetzung: Die eigenen Limits erkennen und wahren.
- Identitätsbildung: Lernen, dass man als eigenständige Person existiert und Bedürfnisse äußern darf.
Gerade bei Kindern ist Egoismus zunächst ein natürlicher Entwicklungsschritt. Kleinkinder sind von Natur aus Ich-zentriert. Erst mit zunehmender Reife lernen sie, dass andere Menschen ebenfalls Bedürfnisse haben – und wie man beides in Einklang bringen kann.
Was Eltern oft meinen – und was Kinder hören
Wenn Eltern „Sei doch nicht so egoistisch“ sagen, wollen sie in den meisten Fällen Folgendes ausdrücken:
„Achte auch auf andere. Teile. Seirücksichtsvoll.“
Das Problem: Kinder übersetzen solche Sätze häufig ganz anders – vor allem, wenn sie noch klein sind. In ihrer Wahrnehmung kann daraus werden:
„Deine Wünsche sind nicht wichtig.“
„Ich darf nicht für mich einstehen.“
„Rücksicht nehmen ist wichtiger als meine eigenen Bedürfnisse.“
Wird diese Botschaft häufig vermittelt, kann sich das tief ins Selbstbild einprägen.
Langfristige psychologische Folgen
Je nachdem, wie oft und in welchem Ton solche Aussagen kommen, können sich folgende Tendenzen entwickeln:
1. Schwaches Selbstwertgefühl
Das Kind lernt: „Ich bin nur gut, wenn ich mich zurücknehme.“ Im Erwachsenenalter kann das dazu führen, dass man sich ständig anpasst, um gemocht zu werden.
2. Schwierigkeiten bei der Abgrenzung
Wer seine eigenen Bedürfnisse als „egoistisch“ abgespeichert hat, sagt seltener „Nein“ – selbst dann, wenn es nötig wäre. Das erhöht die Gefahr von Überlastung und Ausnutzung.
3. Übermäßige Selbstkritik
Betroffene neigen dazu, sich schuldig zu fühlen, sobald sie etwas nur für sich tun – selbst bei völlig gesunden Formen der Selbstfürsorge.
4. Geringere Fähigkeit zur Selbstbehauptung
In Konflikten ziehen sie sich eher zurück, statt ihre Position zu vertreten, aus Angst, „egoistisch“ zu wirken.
Wie es besser geht
Statt pauschal „Sei doch nicht so egoistisch“ zu sagen, ist es hilfreich, konkret das störende Verhalten zu benennen und gleichzeitig die Bedürfnisse des Kindes anzuerkennen:
„Ich verstehe, dass du das Spielzeug gerade selbst haben möchtest. Aber Max möchte auch damit spielen. Lasst uns überlegen, wie ihr beide drankommen könnt.“
Das vermittelt dem Kind:
- Deine Wünsche sind okay.
- Auch andere haben Wünsche.
- Es gibt Wege, beide Seiten zu berücksichtigen.
So lernen Kinder, eigene Bedürfnisse zuäußern, ohne andere zu übergehen – die Grundlage für gesunde Selbstbehauptung und Empathie.
Egoismus ist nicht automatisch ein Mangel an Empathie – er ist oft der erste Schritt zu einem gesunden Selbst.
Unsere Aufgabe als Erwachsene ist es, Kindern beizubringen, wie sie das „Ich“ und das „Wir“ in Balance halten können.